Schelmenblick: Hans Peter Feldmanns skurriles Werk im Kunstpalast Düsseldorf
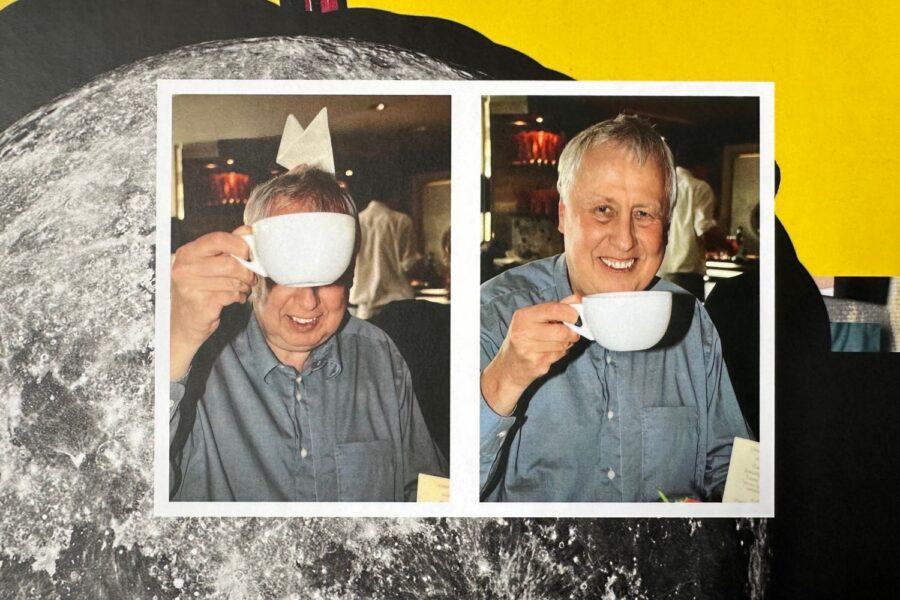
Er war der Außenseiter unter den Düsseldorfer Künstlern. Gab nicht Küsschen auf Vernissagen, wollte nicht mitspielen, auch keine Extravaganz zelebrieren. Als ihm der Druck zu blöd wurde, machte Hans-Peter Feldmann zehn Jahre lang Kunst-Pause. Aber die Verehrer verloren ihn und seinen schelmischen Geist nie aus den Augen. Zu den Fans gehört Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalastes. 2021 verabredete er mit Feldmann die wunderbar skurrile Schau, die jetzt am Ehrenhof zu sehen ist. Der alte Herr suchte die Säle aus (Erdgeschoss) und trank manchen Kaffee mit Kuratorin Felicity Korn. Aber er starb im Mai 2023 mit 82 Jahren – lang, bevor seine Pläne wahr wurden.

Banale Gegenstände dienten Feldmann als „Ästhetische Studien“. Er setzte sie auf Papp-Podeste. Foto: bikö
So schwebt ein Hauch von Melancholie über der Schau, die voller Witz ist aus der Zeit, als das Smartphone uns noch nicht mit seiner Bilderflut betäubt hatte. Feldmann, der lange mit seiner Frau Uschi einen Kramladen an der Wallstraße betrieb, öffnet den Blick für das Wunderland des Alltags. Er sammelte banale, kuriose und verspielte Gegenstände, um daraus Kunst zu machen. Scheuerschwämmchen, Lesebrillen, Tesafilm-Spender präsentierte er auf Podesten wie kleine Skulpturen („Ästhetische Studien“).
Schattenspiel

Eine schielende Nofretete und ein schwarzer „David“. Feldmann liebte es, mit der heiligen Kunstgeschichte zu spielen. Foto: bikö
Umgekehrt holte er mit Vergnügen die abgesegnete Kunst vom Sockel der Unantastbarkeit, indem er sie kopierte und veränderte. Der „Nofrete“ verpasste er einen Silberblick, und Michelangelos „David“ färbte er schwarz. Einer wie Feldmann, sagt Felicity Korn, könne Kunsthistoriker „zur Verzweiflung bringen“. Nichts war ihm heilig. Dafür sorgte er dafür, dass sie und ihr Team „viel gelacht“ hätten beim Aufbau der „Kunstausstellung“. Diesen schlichten, subtil ironischen Titel hatte Feldmann vorgegeben. Und seinen reichen Nachlass an Dingen, Büchern, Bildern.

Feldmanns „Schattenspiel“: Spielzeug und andere Gegenstände drehen sich langsam und werfen gespenstische Bilder an die Wand. Foto: bikö
Die Kuratorin war so frei und hat versucht, „chronologisch zu arbeiten“. Eine Herausforderung, denn Datierungen haben Hans Peter Feldmann nicht so interessiert. Schließlich wuchsen seine Konzepte über Jahre und verwandelten sich wie etwas Lebendiges. Das gilt nicht nur für das „Schattenspiel“ von etwa 2002, eine Installation mit Puppen, einer Pistole, einer Haarbürste und allerlei Klimbim, der sich vor Scheinwerfern dreht, was einen geheimnisvollen Geistertanz an die Wand zaubert. Ja, das erinnert an Platons Höhlengleichnis. Denn der Narr ist auch ein Philosoph.
Postkartengruß

Umgestürztes Auto? Ein Fall für die Polizei? Aber nein: ein Kunstwerk nach dem Konzept von Hans-Peter Feldmann. Foto: bikö
Was das Original ist, lässt sich oft schwer sagen. Jedenfalls nicht der dunkelgrüne Golf, der leicht verdötscht auf dem Dach liegt – neben normal parkenden Mitarbeiter-Autos vor dem Museum. Schon 2010 in London und 2013 in Hamburg hat Feldmann mit (anderen) verdrehten Autos die Passanten irritiert. In der Konzeptkunst ist die Idee das eigentliche Werk. Der Gegenstand oder die Abbildung selbst dürfen unter Umständen einfach ersetzt werden. Das gilt auch für ein Regal voll bunter Postkarten mit „Grüßen aus Düsseldorf“, die sich jede(r) aus der Ausstellung mitnehmen kann: „Take Me I’m Your’s“. 1995 von Feldmann in die Welt gesetzt, massenhaft nachgedruckt.

Am Anfang malte Hans-Peter Feldmann (1941-2023) noch. Doch bald schon wechselte er zur Konzeptkunst. Foto: bikö
Am Anfang immerhin hängen zwei Bilder, die er in den frühen 1960er-Jahren malte: ein roter Kasten und eine Schublade mit labyrinthischen Innenfach. Doch der junge Mann, der von der Düsseldorfer Akademie abgewiesen worden war und in Linz studierte, traute den herkömmlichen Künsten schon damals nicht und beklebte die Rückseiten der Gemälde mit zahllosen Ausschnitten aus Magazinen: Girls, Action, Sektflaschen. Der Konzeptkünstler war geboren. Alles konnte Kunst werden. Auch ein abgetretener Teppich, auf dem eine Modelleisenbahn ihre Runde dreht. Oder ein Hüpfspiel für Kinder, auf den Boden gemalt.
Sonntagsbilder

Aus Pinnwänden voller Postkarten wurde ein „Triptychon Sitzende Frauen“. Daneben hängt ein Stuhl am Hosenträgern an der Wand. Foto: bikö
Und Klauen war erlaubt. Auf der Documenta 1977 zeigte Feldmann zuerst seine „Sonntagsbilder“, Kopien von Fotografien, die eine heile Welt zeigen: Kind mit Hündchen, Liebespaare, Stute mit Fohlen, Schwäne auf dem See. Drei Pinnwände voller Kunstpostkarten wurden zum „Triptychon Sitzende Frauen“. Daneben hängt ein Stuhl an Hosenträgern als unbetiteltes Wandobjekt. Das Gewöhnliche und das Erhabene treffen sich in absurder Harmonie. Hinter Vitrinen voller Zeug – vom Bierdeckel bis zum Metermaß, vom Kartenspiel bis zur Zahnbürste – hängen klassische „Seestücke“ an einer dunkelrot gestrichenen Wand. Sonderbar leer sehen die Ölschinken aus. Feldmann hat alle Schiffe, Möwen und dramatischen Zugaben übermalen lassen.

Vitrinen voller Krimskrams und leergemalte „Seestücke“: skurrile Arrangements aus dem Universum von Hans-Peter Feldmann. Foto: bikö
In listigen letzten Werken geht es immer wieder ums Verschwinden. 50 gerahmte Bilder lehnen mit dem Motiv zur Wand. Ein roter Vorhang verbirgt nur den weißen Saalanstrich. Aufgemalte „Lichtflecken“ deuten abgehängte Bilder an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber Feldmann konnte auch ganz anders: Am Tag nach dem Attentat auf das World Trade Center im September 2001 sammelte er Titelseiten von Zeitungen aus aller Welt, die den Betrachter direkt in die Erinnerung führen. Ganz still und persönlich ist eine Reihe von 101 Porträts, die Feldmann selbst fotografierte: Menschen in allen Lebensaltern, vom neugeborenen Baby Felina bis zur 100-jährigen Maria Victoria. Sie blicken uns ernst an, einfach so, ohne große Pose, und erzählen vom Lauf der Zeit, von Vergänglichkeit.

Tödlicher Ernst: Am 12. September 2001 sammelte Feldmann die Zeitungen aus aller Welt mit den Titelseiten über das New Yorker Attentat. Foto: bikö
Was, wann und wo?
„Hans-Peter Feldmann: Kunstausstellung“: bis 11. Januar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf, Ehrenhof 4-5. Geöffnet Di.-So. 11 bis 18 Uhr, Do. bis 21 Uhr. Eintritt: 16 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Der Katalog ist im Walther und Franz König-Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Informationen über Führungen und Begleitprogramm: www.kunstpalast.de

Das Nichts zelebrieren: 50 Ölgemälde werden nach Feldmanns Konzept mit dem Motiv zur Wand aufgestellt. Foto: bikö
